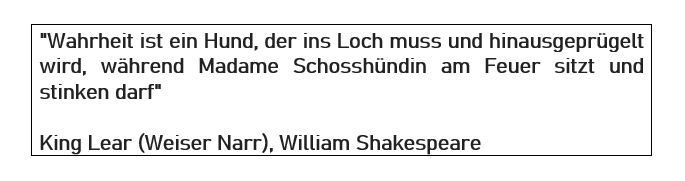Auch wenn mich der eine oder die andere aus Sympathie für die Nummer 1 der Tenniswelt jetzt für einen Südtirol-Verräter hält, so sei reinen Gewissens und ehrlichen Herzens gesagt: Ich bin nicht irritiert, sondern entsetzt bis empört, welch nicht einmal salomonisches, sondern die eigenen Regeln verhöhnendes Urteil die WADA in einem unverholenen Kuhhandel in der seit fast einem Jahr anhängigen Doping-Causa von Jannik Sinner gefällt hat.
Nach dem geflügelten Wort: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, haben sich die juristischen Angsthasen in Lausanne nicht geniert, den zweimal aus welchen Gründen auch immer im März 2024 binnen zwei Wochen in Indian Wells und Miami positiv auf ein Dopingmittel getesteten Grand-Slam-Sieger und Weltranglistenersten zwar für (mit) schuldig zu erklären, nichtsdestotrotz aber nachträglich nur für lächerliche drei Monate zu sperren – von Anfang Februar bis April 2025, ohne dem Sympathikus aus Sexten bei Bruneck weder die 2024 eroberten Grand-Slam-, Masters- und sonstige Titel, geschweige denn Abermillionen an Preisgeld abzusprechen bzw. wegzunehmen. Ein Urteil, das alle anderen bis zu vier Jahre, wenn nicht lebenslänglich wegen ähnlicher Vergehen ausgeschlossenen Sportler: Innen vor den Kopf stößt und unter fadenscheinigem Vorwand auch den Antidoping-Feldzug ins Lächerliche zieht, wenn nicht ad absurdum führt.
Hinter diesem Quasi-Freispruch, der ja nach einem ähnlichen Urteil gegen die fünffache polnische Grand-Slam-Siegerin und aktuelle Weltranglistenzweite Iga Swiatek keineswegs überraschend kam, stecken ganz ohne Schwurbelei meiner bescheidenen Meinung nach zwei Fakten bzw. Faktoren. Zum einen die Absicht des Tennis-Weltverbandes wie der ATP (und WTA), sich keine Galionsfiguren herausschießen zu lassen. Zum anderen die latente Gefahr, dass Sinner mit seinem Management samt Anwälten womöglich eine hohe Millionenklage eingebracht hätte – nicht in Europa, sondern in den USA, wo er ja die Dopingtests mit dem ans Märchenhafte grenzenden Argument begründet hat, sein (inzwischen entlassener) Masseur hätte ihm das Dopingmittel mit einer Wundsalbe auf einem verletzten Finger in den Körper geknetet. Nicht nur in Indian Wells, sondern 14 Tage später auch in Miami. Langzeitwirkung sozusagen…
Eine interessante Version, die an die Zahnpasta-Story des deutschen 5000m-Olympiasiegers Baumann ebenso erinnert wie an die Lippenbalsam-Erklärung der norwegischen Langlauf-Ikone Theres Johaug, die erst so gut wie exkulpiert worden war, ehe sie doch für zwei Jahre gesperrt wurde. Und die Zwangspause dazu nützte, um als junge Mutter diesen Winter ein Comeback zu feiern, das nicht von schlechten Eltern war und immer noch ist. So sehr man Jannik Sinner als tollen Könner und netten Kerl schätzt – in besagter Causa müssen einem da zwei Herzen in der Brust schlagen. Der Persilschein, der ihm mit einer skurrilen Pseudo-Sperre ausgestellt wurde, verletzt nicht nur die Anti-Doping-Regeln, sondern verspottet auch das Gleichheitsprinzip.
Ohne jetzt im nachhinein die jahrelange, medial noch genüsslich verbreitete Hexenjagd gegen heimische Loipen- oder auch Radprofi-Nullern anzusprechen, so kann ich nur sagen: Frag nach bei Tennis-Superstar Simona Halep, der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin und ehemaligen Nummer 1, deren nach 18 Monaten aufgehobene 4-Jahres-Sperre letztlich und kürzlich das Karriere-Ende der mittlerweile 34-jährigen Rumänin bedeutete. Jener Simona Halep, die so nebenbei in ihrer Glanzzeit vom gleichen Touring-Coach betreut wurde wie Jannik Sinner.
Aber in Zeiten wie diesen, in denen mit der Wahrheit nicht nur im Sport oft so umgegangen wird wie beim untenstehenden Spruch aus Shakespeares King Lear, ist das bei einseitiger Betrachtungsweise auch für die Medien so gut wie kein Thema…