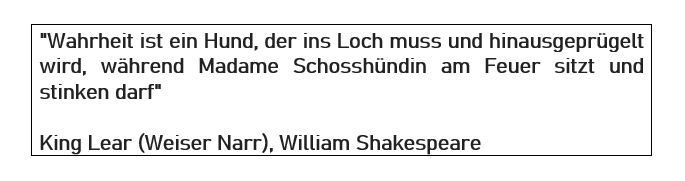Er führte mit Zwei-zu-Null-Sätzen, der Generationswechsel im Herrentennis schien fast schon vollzogen, aber der Schein trog. Novak Djokovic, der serbische Tennis-Mann, der immer öfter gewinnt, weil er nicht und nicht verlieren will, drehte das Match gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas, um mit den French Open nach fünf Sätzen und 4:19 Stunden seinen 19. Grand-Slam-Titel zu gewinnen.
Offenbar hatte der „Djoker“ erst die ganze Euphorie über die gelungene Roland-Garros- Revanche gegen Nadal abschütten müssen, um die innere Zufriedenheit mit sich selbst wieder in die bei ihm schon gewohnte, fast martialische Verbissenheit zu verwandeln. Ja, man könnte es auch so sagen: Nichts kann in einem Schlagabtausch mit Djokovic gefährlicher sein und werden, als den Leu im Serben zu wecken, den man sehen kann, wenn man in seine flackernden Augen blickt.



Wann sonst, wenn nicht da lässt sich ahnen, wie es im Innersten von Djokovic brodelt. Nach außen hin oft eine Eisblock-Fassade, als wollte sie aufkommende Erschöpfung verbergen, dahinter aber ein Feuer speiender Vulkan, der im Siegesfalle mit einem Trommelwirbel an Emotionen ausbricht: Jubelschreie, Freudensprünge, ja sogar Fußtritte gegen alles, was sich an Banden in den Weg stellt. Es ist dieses unglaubliche Kontrastprogramm an gebündelter Selbstdisziplin zum einen, Widerstandskraft und Siegeswillen zum anderen, das Djokovic seit eineinhalb Jahrzehnten zum Dritten im Bunde einer der außergewöhnlichsten Tennisgenerationen aller Zeiten gemacht hat.
Nach dem zweiten Triumph bei den French Open in Paris seit 2016 fehlt dem „Djoker“ nur noch ein einziger Sieg, um mit 20 Grand-Slam-Titeln zu Federer und Nadal aufzuschließen – jenem Duo, das bestimmt eine der Herausforderungen war, dass der verhinderte Skirennläufer aus dem serbischen Bergland zu einem der besten Tennisspieler aller Zeiten geworden ist. Zu einem Alleskönner, der aber vor allem dann, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, also immer dann, wenn es scheint, als würde er verlieren, die Flucht nach vorn antritt – ganz so wie es ja tatsächlich auch für ihn beim Balkankrieg der Fall gewesen war.
Der frühere ORF-Tennis-Experte Andreas Durieux, inzwischen als Mentaltrainer (und Buchautor) unterwegs, kommt in seiner Djoker-Analyse zu dem einleuchtenden Schluss, „dass er der Beste ist, was das Krisenmanagement betrifft!“ Ob aus Intellekt oder Instinkt, wenn Djokovic den Löwenmut entdeckt, dann sind Verbissenheit und Biss eins. Nach Nadal hat´s auch Tsitsipas am eigenen Leib verspürt. Wie für Landsfrau Sakkari, so heißt´s auch für den ersten Griechen-Finalisten, was Grand-Slam-Titel und Generationswechsel betrifft: Bitte warten, solange sich Sportler wie Novak Djokovic nicht um de Burg geschlagen geben wollen, koste es, was es wolle.