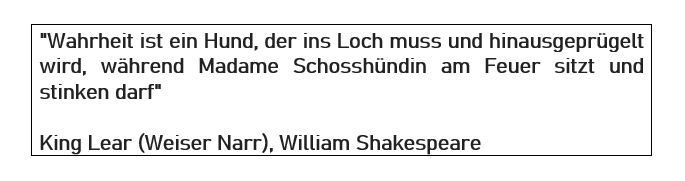Paris. French Open. Roland Garros. Zweimal Endspiel. Viermal Semifinale. Einst Wohnzimmer. Jetzt Rumpelkammer. Vom Thiem zum Thieminho bis zum Thieminhissimo! Handgelenksverletzung hin, lange Pause her, damit allein lässt sich frei nach dem Servus-Alex („Wes´ Brot ich ess´, des´ Lied ich sing“) die immer beängstigendere Abwärtsspirale statt eines erhofften Aufwärtstrends des US-Open-Siegers 2020 nicht mehr erklären.
Mimik, Gestik, Körpersprache – alles spiegelt nicht unbeugsamen Widerstandswillen, sondern eher schon Selbstmitleid, Selbstaufgabe, wenn nicht eine subtile Form von Selbstvernichtungstrieb, wie es einige ehrliche Top-Experten schon seit langem registriert und artikuliert haben. Wer gedacht hätte, der spezielle Paris-Sand und die fabelhaften Erinnerungen an Roland Garros würden wirken wie Katalysatoren, der hatte sich geirrt, der Domi-Motor stotterte derart, dass er schon nach zwei Stunden mit 3:6, 2:6, 4:6 den Geist gegen den nicht viel mehr als soliden Bolivianer Hugo Dellien (Nr. 87) aufgab.
Die Zeit der Ausreden und des Schönfärbens, der Mitleid- nach der Armschiene, sollte nach der desaströsen Paris-Pleite endgültig vorbei sein, weil ja angesichts des Basiskönnens von Thiem alles einfach so nicht sein kann und darf, wie es sich aktuell abspielt – und von Zahlen und Ziffern belegt wird, die nicht trügen. In sieben Comeback-Matches hat Thiem sieben Niederlagen kassiert, einen Satz (gegen den Hartplatzspieler Millman, Aus) gewonnen, aber 15 Sätze verloren.
Gegen Dellien waren einige spektakuläre Bälle im wahrsten Sinn für den Hugo, weil das Endresultat unterm Strich buchstäblich seitenverkehrt war: 69 Punkte für Thiem, der keinen Breakball hatte, aber 96 Punkte für den Bolivianer, obschon der n1ur 4 von 11 Breakbällen verwandeln konnte. Von den vielen leichten unerzwungenen Fehlern, die nicht nur aufs Handgelenk zurückzuführen waren, ganz zu schweigen. Detto von der eher bescheidenen Beinarbeit, die einst ein Trumpf war.
Das führt uns und vor allem mich zwangsweise zur Frage, was Thiem nicht nur im Match, sondern vielleicht auch schon in der Vorbereitung alles falsch macht? Denn beinharter Arbeit Lohn sind normalerweise Erfolgserlebnisse, erst die kleinen, dann die größeren, frag und schlag nach bei einem Andy Murray, der schon einige Hüft-Operationen hinter sich hat – oder bei „Stan the Man“ Wawrinka, der nach Knie-OP und 15 Monate langer Zwangspause bereits beim dritten Comeback-Turnier die ersten Siege und ein Achtelfinale beim Rom-Masters feierte. Ich fürchte, dass für Dominic Thiem das viele Geld, das er mit seinen 17 Turniersiegen verdient hat, wie ein schleichendes Gift wirkten, das – nicht menschlich, aber sportlich – den Charakter verdorben haben. Und ich meine, dass es aller höchste Zeit wäre, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Betreuung etwas entscheidend zu verändern.
Gut möglich, dass – angeknackstes Selbstvertrauen hin, fehlende Schlagsicherheit her – der beste kheimische Tennisspieler seit Thomas Muster jemanden als Trainer, Mentor oder gar „Diktator“ braucht, der ihn nicht mit Salben schmiert, sondern mit brutaler Offenheit und Ehrlichkeit zumindest verbal in den Hintern tritt. Wie gesagt – Mimik, Gestik, Körpersprache bilden bei Dominic Thiem derzeit eine fatale, sportlich letale Einheit, die ihn nicht aus der Sackgasse führt, sondern von Marbella über Belgrad, Estoril, Madrid, Rom und Genf bis zum schnellsten Paris-Aus begleitet hat, das er je erlebt hat. Gretchenfrage: Wer gibt ihm den richtigen Schlüssel, um der Rumpelkammer zu entfleuchen? Na Servus – ein paar Bullen-Dosen werden da wohl sicher nicht reichen …