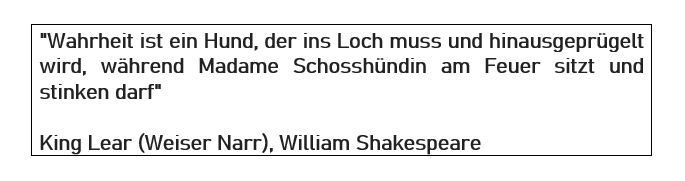Tennis und seine verletzten Topstars, das wächst sich immer mehr zu einer unendlichen Geschichte aus. Reden wir nicht von Federer, Nadal, Wawrinka, Murray und seit Monaten auch Dominic Thiem als jüngstem der Topspieler. Zuletzt hat Stefanos Tsitsipas in Paris vorsichtshalber mit einem zwickenden Ellbogen aufgegeben, um das ATP-Finale nicht aufs Spiel zu setzen.
Und was ist dann schon im zweiten Einzel des ersten Tages bei der Final-Premiere in Turin passiert? Ausgerechnet Matteo Berrettini, Wimbledon-Finalist und Lokalmatador, der gegen Olympiasieger Zverev vor dem Satzgewinn zu stehen schien, ehe er ihn doch noch im Tie-Break (trotz Führung) verlor, ließ nach einem Mishit mit einem Aufschrei das Racket fallen, griff sich an die Hüfte, dann an den Kopf, wurde massiert, wollte weiterspielen, konnte aber weder auf- noch zurückschlagen.
Binnen Sekunden hatte sich der Traum, italienische Tennisgeschichte zu schreiben, in einen tragischen Alptraum verwandelt. Ob es gelingt, ihn für das zweite Match fit zu machen, scheint fraglich. Für die Tifosi tröstlich, dass mit Jannik Sinner, 20, immerhin ein Italiener aus Südtirol als alternativer Publikumsliebling zur Verfügung stünde. Aber das ist eine Tifosi-Tennis-Geschichte für Bella Italia. Worauf ich in meiner Betrachtung aber hinauswill, das hat mit lokalpatriotischer Enttäuschung nichts zu tun.
Ich bin zwar Freund und Anhänger von Traditionen im Sport, ob es jetzt Derbys sind im Fußball oder es Bewerbe waren wie der althergebrachte, inzwischen runderneuerte Davis- oder der noch unveränderte Ryder-Cup im Golf, ob VAR-freier Fußball oder klassische Skirennen – manch eines aber passt heutzutage deshalb nicht mehr, weil sich die begleitenden Parameter und Umstände bisweilen dramatisch geändert haben.
Auch und vor allem im Tennis, man denke nur an optimierte Schläger, erhöhte Ballbeschleunigung, Schläge mit Highspeed, nicht ganz gedämpfte Vibrationen, gesteigerte Laufarbeit, extrem beanspruchte Muskeln, mentalen Stress, Hetzjagd nach Punkten und Erfolgen, verbunden mit Reisestrapazen und Jetlag. All das, mit Verlaub, hat es früher nicht in diesem Ausmaß gegeben, als vor allem (Spitzen-)Tennis bei weitem nicht so professionell aufgestellt und organisiert war wie heute.
Früher gab´s Stars, die spielten vielleicht 10 Turniere meist auf Rasen oder Sand und dazwischen spaßeshalber Exhibition – mittlerweile hat ein Alexander Zverev nicht weniger als 19 Turniere und alles in allem 70 Matches auf vier Kontinenten in Armen und Beinen. Wäre kein Wunder, würde es auch bei ihm am Ende eines langen Jahres mit einem Schlag so zwicken und zwacken, dass es nicht mehr weiter geht.
Als man in den siebziger Jahren das Masters als heimliche Weltmeisterschaft als finalen Knüller einführte, als das Daviscup-Finale in klassischer Form als krönender Saisonabschluss inszeniert wurde, gingen die Uhren sozusagen noch ganz anders. Man hat an diesen alten Terminen festgehalten, ohne mit der Zeit zu gehen, die bei den Besten der Besten, die auch auf höchstem Niveau mehr, öfter und länger spielen als die zweite, dritte und vierte Garde, ihre /Verletzungs-)Spuren immer öfter hinterlässt.
Statt traditionelle Bewerbe und Regeln auch im Sinne des TV-Diktats zu brechen, wenn nicht zu ruinieren, sollten sich Tennis-Granden einmal überlegen, ob man nicht diverse Titel-Turniere zwischen Grand-Slams in der Jahresmitte als am Saisonende zu spielen, wenn die Stars schon geschlaucht sind, auf dem Zahnfleisch gehen oder aufgeben müssen wie zuletzt der fassungslose, bemitleidenswerte, frustrierte Lokalmatador Berrettini. Seine Aufgabe war ein echtes Alarmsignal und alles andere denn ein Zufall. Hilfe, am.Ende der Saison sind wir mit unseren Kräften am Ende…