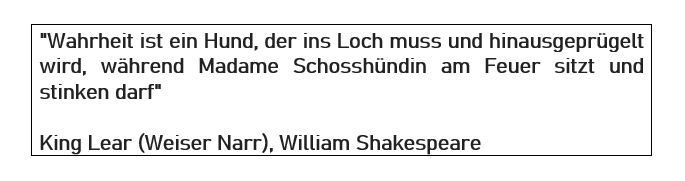Action, Action, Action. Und Drama. Drama. Drama. Der erste Formel-1-Grand-Prix in der von vielen Hispanics bevölkerten Millionenstadt Miami brachte alles, was das Herz der Rennsportfans auf bummvollen Tribünen höherschlagen ließ. Für alle, die gern an RedBull-Cocktails nippen, mit Max Verstappen den richtigen, für die Ferrari-Anhänger zwar den falschen Sieger, aber als Trostpflaster immerhin zwei Podestplätze. Und für die Deutschen, ob Mercedes (Siebenfachweltmeister Hamilton als Sechster hinter Teamkollegen Russell) oder Vettel und Schumacher-Filius Mick, die kollidierten statt punkteten, einen weiteren Dämpfer.



Wo aber, so wird sich manch einer fragen, blieben die US-Amerikaner beim Heimrennen? Fehlanzeige! Mit dem Mexikaner Perez nur ein Mittelamerikaner am Start, ansonsten gab es sie nur in der Starparade aus allen möglichen Lagern, von Michelle Obama, die aber kein guter Stern für Mercedes war, über die populären Allzeitgrößen aus Film (Michael Douglas), Basketball (Michael Jordan), Tennis (Serena Williams), Soccer (Beckham), Ex-LA-Königen und Neo-Transgendern wie Bruce, Pardon: Caytlin Jenner, und einigen bekannten Namen aus der IndyCar- und anderen US-Motorsportszenen, darunter jener Janica Patrick, die Bernie Ecclestone als erste IndyCar-Siegerin so gerne in die Formel 1 transferiert hätte. Konjunktiv, weil sie lieber Stock-Car-Races statt Grand-Prix-Rennen bestreiten wollte.
Ob sie jetzt gefahren wäre oder nicht, mehr als ein ausverkauftes Haus und viel mehr und bessere Werbung vor einer Premiere wie jetzt in Miami hätte es ja kaum geben können. Aber das, werte Blog-Leser, hat es ja schon immer gegeben, wenn die Formel 1 irgendwo in den Vereinigten Staaten das erste Mal die Tür zum Big Business hatte aufstoßen wollen, auch immer wieder mit Prominenten als Aufputz, man denke nur an Weltstar Paul Newman in Detroit, an halb Hollywood in Long Beach, an Memento Mori Kennedy in Dallas usw. Aber nach dem tollen Formel-1-Re-Start wich dann selbst in und vor allem nach den Zeiten eines Weltmeisters wie Mario Andretti die Euphorie der Ernüchterung.
Wer wie meine Wenigkeit ganz große Events in den USA erlebt hat, von Ali, Frazier, Foreman im Ring über Schwimm-Granden von Spitz bis Phelps, LA-Größen von Carl Lewis und Maurice Greene bis Zehnkampfriese Ashton Eaton, von Basketball-Giganten wie Chamberlain, Jordan bis LeBron James und Co, von Evert und Connors bis zu den Williams-Sisters und Andy Roddick, von Jack Nicklaus bis Tiger Woods, von Bode Miller bis Lindsey Vonn– der ziemlich nationalistisch angehauchte amerikanische Lokalpatriotismus entscheidet fast immer über den Langzeiterfolg eines Events und damit auch darüber, ob die Kassa mehr als nur einmal wirklich klingelt.
Vergessen wir in diesem Zusammenhang nicht, dass das amerikanische Football-Finale, die Super Bowl, in den Staaten als Weltmeisterschaft vermarktet und verkauft wird. Und weil dem so ist, wie es ist, erschienen die Top drei wie aufgefädelt bei der Siegerehrung in Miami mit – jawohl: mit Football-Helmets statt den normalen des Motorsports. Die neuen Formel-1-Besitzer, voran Schnauzbart Carey als CEO, sind eben Amerikaner. Und sie werden schon wissen, wie man langfristig die Formel 1 in ihrem eigenen Land allmählich sesshaft macht. Nicht nur mit der Hymne und Hand aufs Herz vor dem Start bis zum Footballhelm nach dem Rennen. Am besten mit einem Amerikaner am Podest – und in den USA!